Nach dem Krieg braucht es eine gemeinsame Ordnung

Nach dem Krieg braucht es eine gemeinsame Ordnung – Seite 1
Jan Plamper ist Russlandexperte und Professor für Geschichte an der University of Limerick. Er war einer der Erstunterzeichner des Appells "Der Ukraine helfen, diesen Kriegswinter zu überstehen!" im November 2022 und des Aufrufs zur Demonstration am 24. Februar 2023, "Das Ungeheuerliche nicht hinnehmen!".
Erst die Annexion der Krim und der Krieg im Donbass 2014, dann die Angriffseskalation am 24. Februar 2022, in ihrer Folge die Kriegsverbrechen – die russische Schuldlast ist erdrückend. Ist es überhaupt angebracht, öffentlich Überlegungen zu einer Nachkriegsordnung anzustellen, die für Russland einen anderen Status als den eines auf lange Sicht geächteten Pariastaates vorsieht?
Auf den ersten Blick scheint es, als könnte es Verrat am ukrainischen Widerstand darstellen, über so etwas nachzudenken. Für eine solche Diskussion spricht jedoch, dass sie einen Teil der russischen Bevölkerung erreichen und damit kriegsstrategisch pro Ukraine wirksam werden könnte. Überlegungen hinter verschlossenen Türen, wie sie in westlichen Geheimdiensten, Thinktanks sowie ministeriellen Planungsstäben stattfinden, erreichen die Russinnen und Russen nicht. Wie aber in den westlichen Medien laut über die Zukunft nachgedacht wird, registrieren noch zweifelnde oder schon oppositionelle netzaffine Bürgerinnen und Bürger Russlands sehr wohl. Indem Wege zur Rückkehr in den Kreis "zivilisierter Länder" vorgezeichnet werden, könnten sich mehr von ihnen von Wladimir Putin abwenden.
Trotz der Unterstützung für den Krieg – zuletzt waren 74 Prozent in einer Umfrage dafür – würde in Russland eine Umfrage zur bündnispolitischen Zukunft wohl andere Ergebnisse zeitigen. Gefragt etwa, ob sie sich langfristig eher in einem chinesischen oder einem europäischen Block sehen, würde sich höchstwahrscheinlich eine große Mehrheit für Europa aussprechen. In Russland gibt es tiefe Ängste vor der Volksrepublik, vor schleichender chinesischer Einwanderung – sie findet entlang der 4.200 Kilometer langen Grenze statt, wo 1,4 Milliarden Chinesen 146 Millionen Russen gegenüberstehen – bis hin zu einer militärischen Konfrontation.
Historisch spricht für solche Überlegungen zur ferneren Zukunft gerade aus deutscher Perspektive, dass sie in der Vergangenheit oft kriegsbeeinflussend waren, im Guten wie im Schlechten. So war es US-Präsident Woodrow Wilsons 14-Punkte-Programm zur Neuordnung Europas auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts der Völker vom Januar 1918, das im Laufe des Jahres positive Wirkung entfaltete. Als sich im Sommer dieses Jahres die Niederlage abzeichnete, begannen immer mehr Deutsche, sich eine friedliche Zukunft auf der Basis des Programms vorzustellen, was wiederum das Kriegsende beschleunigte. Anders im Zweiten Weltkrieg. Im August 1944 geriet der Morgenthau-Plan in Umlauf, der die Demilitarisierung, Deindustrialisierung und Föderalisierung vorsah, sodass nie wieder von Deutschen ein Krieg angezettelt werden könnte. Das eigentlich geheime Memorandum von US-Finanzminister Henry Morgenthau wurde von der Goebbelsschen Propaganda ausgeschlachtet und war ein Faktor, der die Deutschen weiterkämpfen ließ und die Kapitulation hinauszögerte.
Vom fernen Ende her gedacht
Im Folgenden wird von der militärischen Niederlage Russlands ausgegangen sowie davon, dass im Nachgang aus ukrainischer und völkerrechtlicher Perspektive genug Wiedergutmachung für den Krieg geleistet wurde. Gewiss: eine Prämisse, die das Longue-durée-Gedankenspiel realitätsfern erscheinen lassen mag. Andererseits wird momentan selten von ferneren Enden her gedacht, obwohl sich die Zukunft offener als sonst präsentiert – in Kriegszeiten werden die Karten bekanntlich neu gemischt. Ausdrücklich nicht angedacht werden hier kurzfristige Szenarien, etwa über Friedensverhandlungen oder mittelfristige über einen Regimewechsel in Russland. Noch wird die Vorgeschichte des Krieges aufgerollt.
Was spräche in so einer langfristigen Perspektive also für einen Beitritt Russlands zu EU und Nato? Was dagegen? Welcher Platz Russlands in der Geopolitik verspricht die größten Chancen auf Weltfrieden?
Die letzten Plädoyers von Regierungschefs für einen EU- und Nato-Beitritt Russlands stammen aus der Jahrtausendwende. Damals forderten so unterschiedliche Politiker wie Gerhard Schröder, Silvio Berlusconi und Miloš Zeman einen Beitritt, lagen damit aber nach dem Amtsantritt Putins 2000 oft abseits der öffentlichen Meinung. Später waren die autoritären Züge des Putinismus immer deutlicher hervorgetreten, deshalb wurde ein Beitrag Joschka Fischers von 2009, Russland in die Nato, oder ein Positionspapier des ehemaligen CDU-Verteidigungsministers Volker Rühe von 2010 als noch randständiger wahrgenommen.
Noch in den Neunzigern lagen die Dinge anders. Damals waren Plädoyers für eine Einbindung Russlands in die westliche Sicherheits- und Wirtschaftsarchitektur Mainstream. Auf dem Londoner Nato-Gipfel von 1990 hatte gar die "eiserne Lady" Margaret Thatcher der Sowjetunion "die Hand zur Freundschaft" ausgestreckt. Thatchers Nachfolger John Major sprach 1992 von der Notwendigkeit für die EU, "ihre Fantasie auszuweiten" und einen russischen Beitritt auszuloten. Majors Außenminister Malcolm Rifkind kritisierte 1995 den Nato-Ansatz als "unzureichend fantasievoll" und brachte den Beitritt Russlands ins Spiel.
"Vom Atlantik zum Ural"
James Baker III., von 1988 bis 1992 US-Außenminister unter George Bush Senior, hatte schon 1993 die Nato aufgefordert, "einen klaren Osterweiterungsfahrplan für das Bündnis auszuarbeiten, der die Staaten Mittel- und Osteuropas sowie jene der ehemaligen Sowjetunion, vor allem das demokratische Russland, miteinbezieht". In der Expertengemeinschaft wurde von US-Spezialisten wie Jimmy Carters Sicherheitsberater Zbigniew Brzeziński (1998) und Barack Obamas Sicherheitsberater Charles Kupchan (2010) noch viel aktiver für eine russische EU/Nato-Mitgliedschaft geworben. Und im Zweiten Weltkrieg entwickelte Frankreichs Charles de Gaulle die Vision eines Europas "vom Atlantik zum Ural", die er während seiner Präsidentschaft mit Blick auf den EU-Vorgänger EWG und die Nato immer wieder erneuerte.
Bis in die frühe Putin-Zeit hinein klopfte der Kreml selbst mehrmals im Westen an. Michail Gorbatschow konkretisierte noch 1990 für die UdSSR während der Verhandlungen zur deutschen Einheit seine Rede vom "gemeinsamen Haus Europa". "Sie behaupten, die Nato sei nicht gegen uns gerichtet, es handele sich nur um eine Sicherheitsstruktur, die sich an die neuen Realitäten anpasst", sagte Gorbatschow zu Baker. "Deshalb schlagen wir vor, der Nato beizutreten." Boris Jelzin, bei allem späteren Widerstand gegen die Nato-Erweiterung nach Ostmitteleuropa, schrieb 1991, die Nato-Mitgliedschaft Russlands sei ein "langfristiges Ziel". Und selbst Putin fragte, als amtierender Präsident, kurz bevor er im März 2000 zu Jelzins Nachfolger gewählt wurde, Nato-Generalsekretär George Robertson: "Wann laden Sie uns ein, der Nato beizutreten?" Ähnlich in einem BBC-Interview am 5. Mai 2000 – gefragt: "Ist es möglich, dass Russland der Nato beitritt?" – antwortete Putin: "Ich sehe nicht, was dagegen spräche."
Heute sind es in Russland freilich vor allem die oppositionellen, demokratischen Kräfte, die das Ziel eines Beitritts zu EU und Nato weiter hochhalten. Alle nicht gleichgeschalteten Parteien, von Jabloko bis zu Alexej Nawalnys Fortschrittspartei/Russland der Zukunft, führen es in ihren Programmen. Festzuhalten ist also, dass die Vision eines russischen Beitritts zu EU/Nato nicht schon immer als abwegig galt.
Reformen sind ohnehin nötig
Wendet man sich der Geografie zu, so werden zwei Argumente gegen einen Russland-Beitritt vorgebracht. Russland gehöre nicht zu Europa, heißt es, und Russland sei zu groß. Das erste Argument ist schnell ausgeräumt – Europa ist ein Konstrukt, wo es endet, wird immer wieder neu definiert. Die russische Exklave Kaliningrad liegt westlicher als die baltischen EU-Staaten, und zur EU gehören auch Französisch-Guayana und Französisch-Polynesien. Die Nato macht hier Ausnahmen: So wird etwa bei einem Angriff auf französische Überseegebiete nicht automatisch Artikel 5 ausgelöst – diese Gebiete sind von der kollektiven Verteidigung ausgenommen.
Schwerer ins Gewicht fällt das Argument, Russland würde als größter Flächenstaat der Erde die westlichen Bündnisse sprengen – ein Europa vom Atlantik bis zur Beringstraße würde institutionelle und ökonomische Überdehnung und letztlich Kollaps bedeuten. Ähnliches wird jedoch regelmäßig auch gegen Deutschland vorgebracht. Somit ist das Problem der Größe nicht unbekannt, mit Russlands Beitritt würde es sich lediglich graduell verschärfen. Beide Bündnisse schieben schon lange Reformen vor sich her, die bei immer mehr Mitgliedsstaaten mit sehr unterschiedlichen Flächengrößen, Bevölkerungszahlen und wirtschaftlicher Potenz einerseits die Beschlussfähigkeit, andererseits demokratische Repräsentation garantieren. Diesen Balanceakt zwischen Beschlussfähigkeit und Demokratie so gerecht wie möglich hinzubekommen, erfordert ohnehin neue Mechanismen. Sie liegen seit Jahren in Schubladen bereit: in der EU die Auffächerung in mehr Entscheidungsebenen, etwa durch die Einführung eines Sicherheitsrats; in der Nato hin zu Mehrheitsentscheidungen und weg von einmütigen Beschlussverfahren mit Vetorecht.
Teil einer Wertegemeinschaft?
Wie steht es aber mit der Politik und dem, was ihre Fundierung in "Werten" genannt wird? Im Nordatlantikvertrag von 1949, dem Nato-Gründungsdokument, verpflichteten sich die unterzeichnenden Staaten, "die Freiheit, das gemeinsame Erbe und die Zivilisation ihrer Völker, die auf den Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit der Person und der Herrschaft des Rechts beruhen, zu gewährleisten". Demokratie, Rechtsstaat, liberale Grundrechte und später auch die Marktwirtschaft – Nato und EU verstanden und verstehen sich immer auch als Wertegemeinschaften.
So weltfremd es angesichts der diktatorischen, neoimperial-expansionistischen Züge des Putinschen Russland scheinen mag, aus politisch-normativer Perspektive stellt der Beitritt zu den westlichen Bündnissen die geringste Hürde dar. Denn ein Land muss sich nur zu den Werten bekennen und dann über eine gewisse Zeit hinweg kontinuierlich Taten folgen lassen, um beitrittsfähig zu werden. Mit diesem universalistischen Argument wurde die Nato-Osterweiterung 1999, 2004 und 2009 begründet; selbstverständlich gilt es auch für Russland. Mehr noch: Russlands Beitritt könnte die Kluft zwischen Idealen und Wirklichkeit wieder verringern, wurden doch in der Vergangenheit oft aus machtpolitischen Erwägungen (Kalter Krieg) Ausnahmen gemacht – Spanien und Portugal zum Beispiel waren bei Aufnahme in die Nato 1949 keine Demokratien, Ungarn und Polen sind heute gerade noch illiberale Demokratien.
Gemeinsame Interessen
Fehl am Platz sind in diesem Zusammenhang Essentialisierungen von Geschichte, à la "Die Russen haben keine Erfahrung mit Demokratie" oder gar "der Russe braucht eine starke Hand". Bei solchen herabwürdigenden Kategorisierungen handelt es sich um Mythen mit langen westeuropäischen, slawophoben, rassistischen Genealogien. Sie sind genauso verwerflich wie derzeitige ukrainophobe, rassistische Mythen in Russland.
Weiter: Legt man eine pragmatischere Definition von Politik an – interessengeleitete Realpolitik, oder Verantwortungsethik statt Gesinnungsethik –, so gibt es durchaus gemeinsame Interessen des Westens und Russlands. Die Einhegung des Islamismus in Afghanistan oder dem Nahen Osten gehört bei mittelfristigen Szenarien dazu, der Faktor China (mehr dazu unten) bei langfristigen. Ganz zu schweigen von der Linderung der Folgen des Klimawandels.
Was die sicherheitspolitischen Sorgen der ostmitteleuropäischen Staaten sowie wahrscheinlicher künftiger EU/Nato-Mitglieder wie Ukraine, Georgien und Moldau angeht, so liegt ein Beitritt Russlands gar in deren Interesse. Kein Nato-Staat darf die Integrität eines anderen Nato-Staates infrage stellen. Fast wichtiger noch als die rechtliche, normative Souveränitätsgarantie: die Integration in gemeinsame Waffensysteme, Informationskanäle, Militärübungen, aber auch Visaregelungen, Umweltgesetze, selbst Brüsseler Industrienormen.
Entflechtung statt gigantischer Schurkenstaat
Ein Aspekt schließlich wird leicht übersehen: Supranationale Gebilde wie die EU entschärfen Grenzkonflikte. Der Nordirlandkonflikt ist hier das historische Paradebeispiel. Die wohltuende Kraft der EU war es, die Grenze zwischen Nordirland und Irland weitgehend vergessen zu machen. Wie gefährlich es wieder werden kann, wurde mit dem Brexit schlagartig bewusst. Darüber hinaus gibt es mit den Euroregionen seit 1958 Mechanismen regionaler, grenzübergreifender wirtschaftlicher, kultureller und ökologischer Integration. Wenig bekannt: 2011 ging eine russisch-ukrainische Euroregion Donbass an den Start, also eine von der EU auch finanziell geförderte Grenzregion am Fluss Don. Die Donbass-Initiative ging zurück auf eine russisch-ukrainische Abmachung von 2010, eine aus der russischen Rostower Region und den ukrainischen Donezk- und Luhansk-Regionen bestehende Euroregion zu beantragen. 2014 wurde die EU-Förderung wegen Russlands Annexion der Krim gestoppt.
Auf wirtschaftlicher Ebene wird gegen einen EU-Beitritt oft vorgebracht, Russland sei zu korrupt und die Kluft zwischen Arm und Reich zu groß. Dies sind in der Tat Probleme, deren Lösung jedoch im Interesse aller Beteiligten liegt. Die Verflechtung im Bereich der Rohstoffe und der oligarchischen Wirtschaftskonglomerate ist bekanntlich riesig: Der jetzige Krieg birgt die Chance, die dringend notwendige Entflechtung voranzutreiben, den von Putin versprochenen, nie erfüllten Wandel der Wirtschaft weg vom Petrostaat hin zu einer diversifizierten Ökonomie endlich einzulösen, sogar den Umbau im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit voranzutreiben. Auch in den Bereichen Korruption und organisiertes Verbrechen bietet ein Beitritt eher Chancen der Eindämmung, als wenn Russland zu einem gigantischen Schurkenstaat mutierte.
Das chinesische Modell und seine Grenzen
Bleibt ein Elefant im Raum: China. Noch 2010 hatte der russische Politologe Fjodor Lukjanow auf das Rühe-Positionspapier reagiert: "Peking will auf keinen Fall, dass sich ein militärisch-politisches Bündnis wie die Nato bis an seine Grenzen nähert. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch aufseiten der Europäer wenig Bereitschaft, die Sicherheit Russlands zu garantieren und dafür im Zweifel auch die guten Beziehungen zu China aufs Spiel zu setzen." Seit 2010 hat sich die geopolitische Tektonik drastisch verschoben. Heute ist im Westen Konsens, dass die wirtschaftliche Abhängigkeit von China reduziert und Chinas neoimperiales Hegemonialstreben – Taiwan! – eingedämmt werden muss. Russland teilt, wie gesagt, die Skepsis gegenüber China eigentlich, auch wenn man derzeit auf Peking angewiesen ist.
Manche sehen aber auch eine Chance im aktuellen Krieg für eine positive Entwicklung Chinas, so der Militärexperte Tai Ming Cheung: "Die Lektion des russischen Krieges gegen die Ukraine ist, dass China noch viel mehr Zeit zur Stärkung und Umstrukturierung seines Militärs braucht, bis es die offenkundigen Schwächen und Lücken beseitigt hat, die auf dem ukrainischen Schlachtfeld zutage treten." Darüber hinaus werden die Grenzen des chinesischen Modells immer auffälliger bei Corona-Pandemie, Umwelt, Demografie und letztlich Stabilität. Die Überlegenheit etwa der Demokratie Indiens, bei aller hindunational-populistischen Bedrohung von innen, tritt immer deutlicher hervor.
Und so gilt auch: Bündniskonstruktionen wie EU/Nato, die unter Einbezug Russlands bis an die chinesische Grenze heranreichen, könnten positive Sogeffekte für die chinesische Bevölkerung entfalten. Denn in letzter Instanz wird sich das Fortbestehen unseres Planeten nur durch globale Lösungen von Problemen, die weit über die Grenzen von EU und Nato hinausgehen, garantieren lassen – in der Très-longue-durée-Perspektive werden die Bündnisse einmal in einer Weltföderation aufgehen.
Es ist ein Paradox unserer Zeit: Selten war so viel Zukunft wie im Augenblick, selten war das Langzeitziel in so greifbarer Nähe wie in diesem katastrophischen Moment des russischen Angriffskrieges gegen die souveräne Ukraine.
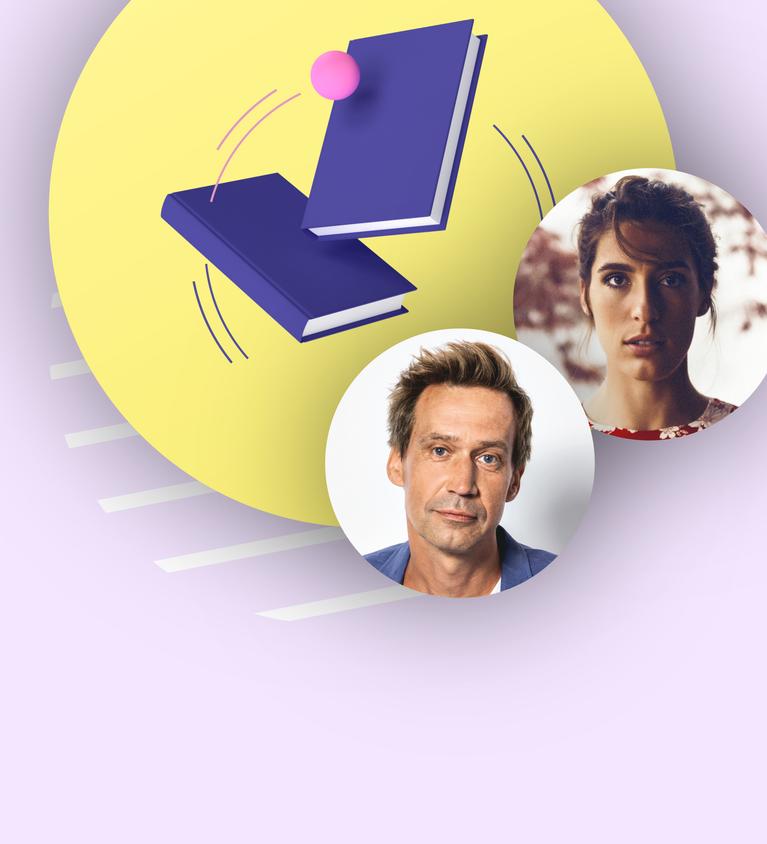
No comments:
Post a Comment